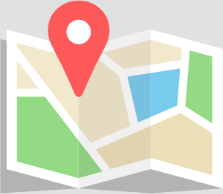Inhalt
Inhaltsverzeichnis
Die Deutschen gelten als Aktienmuffel. Nur 17 Prozent der Privatanleger halten Wertpapiere für eine attraktive Geldanlage – obwohl die Renditechancen in den letzten Jahren von anderen Anlageformen unerreicht blieben. Kaum eine andere Nation legt so einen geringen Anteil ihres Vermögens in Aktien an. Doch woran liegt das? Nur rund neun Millionen Deutsche sind im Jahr 2013 als Privatanleger tätig geworden. Damit hat sich der Wert seit 2010 (8,4 Millionen) zwar weiterhin verbessert, tatsächlich war er im Vergleich zu 2012 wieder rückläufig. Seit der Jahrtausendwende legten 2001 am meisten Deutsche Geld in Aktien an. 12,85 Millionen Privatanleger konnten vor dem Platzen der Dotcom-Blase und der enttäuschenden T-Aktie verzeichnet werden. Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass die Deutschen Aktienmuffel sind: Nur rund 7,5 Prozent der Deutschen haben im ersten Halbjahr 2013 in Aktien investiert. In den Vereinigten Staaten waren es hingegen 56 Prozent, in den Niederlanden 40 Prozent und in Großbritannien 23 Prozent. Selbst in der Schweiz und in Schweden ist die Zahl der Anleger ein Vielfaches im Vergleich zu Deutschland. Und selbst Nachbar Frankreich kann mehr Aktionäre verzeichnen. Insgesamt liegen mit 250 Milliarden Euro nur rund fünf Prozent des Geldvermögens in Aktien. Warum dies so ist, versteht im Ausland kaum jemand. Deutsche Unternehmen gelten als die besten und stabilsten der Welt und dennoch sind es ausgerechnet die Anleger im Heimatland, die die Investition scheuen. Festgeldkonten sind selbst dann beliebter als Wertpapiere, wenn der Zins nicht in der Lage ist, die Inflation aufzufangen. Diese Frage wird tatsächlich seit Längerem von verschiedenen Wissenschaftlern erforscht. Das Argument, dass die Deutschen zu risikoscheu seien, kann aufgrund der Ergebnisse eher als Gerücht eingeordnet werden. Stattdessen gibt es wesentlich bessere Gründe, die Deutsche vor dem Aktienhandel zurückschrecken lassen. Die USA sind absolute Spitzenreiter bei der Anzahl der Aktionäre. Das kommt jedoch nicht von ungefähr. Ein Großteil der Amerikaner nutzt Pensionspläne, die nach dem Gesetzesparagraphen 401 (k) gestaltete sind. Aktien sind ein wesentlicher Bestandteil der Pensionspläne und dementsprechend präsent sind Aktien im alltäglichen Leben. Dies gilt auch für die Niederlande und Skandinavien, wo Aktien ebenfalls eine größere Bedeutung bei der Altersvorsorge einnehmen. Durch das gute soziale Sicherungsnetz, auf das Deutsche jahrzehntelang bauen können, ist dies hierzulande anders. In der Regel verließen sich Deutsche auf die gesetzliche Rentenversicherung und sorgten zusätzlich durch ein Eigenheim vor. Die Investition in Aktien war also nicht notwendig, weniger sicher und für die meisten deswegen unattraktiv. Dass Aktien im Vergleich zu anderen Vorsorgemaßnahmen wie der Immobilie unattraktiv waren, lag auch an den Kosten. Damit sind allerdings nicht die Orderprovisionen oder Depotführungsgebühren gemeint. Dadurch, dass Aktien für viele Menschen uninteressant sind, beschäftigen sich Deutsche auch nicht mit ihnen. Das bedeutet, dass es sie wesentlich mehr Aufwand kostet – nämliche Informationskosten – in den Aktienhandel einzusteigen. Sie müssten sich mit der Börse beschäftigen, Unternehmen sondieren und die Aktienkurse dauerhaft verfolgen. In einer Gesellschaft, in der dieses Thema so wenig im Alltag behandelt wird, ist der Aufwand größer als in anderen Ländern. Wäre Aktienhandel unter den Deutschen so verbreitet, dass die Börse auch außerhalb von Skandalen und bedeutenden Kursänderungen in Alltagsgesprächen auftauchte, wären diese Informationskosten wesentlich geringer. In anderen Ländern ist dies so. Jahrzehntelang war es zudem so, dass auch deutsche Unternehmen bevorzugt Bankkredite als Finanzierungsquelle nutzten. Dies zeigt auch, wie groß das Vertrauen der Deutschen in die Geldinstitute ist. Banken waren lange Zeit der erste Ansprechpartner für sämtliche Finanzfragen, in anderen Ländern gehen Unternehmen er den Weg an die Börse oder erzielen dort Kapitalerhöhungen. Deutsche Unternehmen haben schätzungsweise einen Gesamtwert von 5,7 Billionen Euro. Alle Wertpapiere zusammen haben hingegen nur einen Wert von 1,2 Billionen Euro. Auch die deutschen Unternehmen sind also gerade mal zu 20 Prozent an der Börse vertreten. Der Rest bevorzugt, sein Fremdkapital durch Bankkredite zu erhalten. Demzufolge sind auch von Banken angebotene Finanzprodukte wie Sparbücher und Zinsen interessanter als Aktien. Während in Deutschland fast jedes Kind ein Sparbuch besitzt, sind Aktienportfolios selbst im fortgeschrittenen Alter eine Seltenheit. Dass die Banken einen derartig großen Einfluss haben und sowohl Anleger als auch Unternehmen sich zuerst an diese richten, wird auch als „Pfadabhängigkeit“ bezeichnet. Für Unternehmen ist es günstiger, Kapital über Anleihen oder Bankkredite zu erhalten. Die steuerlichen Abgaben beim Gang an die Börse sind wesentlich kostenintensiver. Während Zinsen für Fremdkapital, das so erzeugt wird, abgesetzt werden können, ist dies beim Börsengang nicht der Fall. Die Finanzierung durch die Ausgabe von Aktien ist im Steuerrecht nicht mit den beiden anderen Alternativen gleichgestellt. Ähnliches gilt auch für die Aktionäre, die beim Aktienkauf gleich mehrfach belangt werden. Zum einen müssen sie mit der Abgeltungssteuer in Höhe von 25 Prozent plus Solidaritätsbeitrag und Kirchensteuer denselben Steuersatz zahlen wie Zinssparer. Dabei wird jedoch vernachlässigt, dass der Gewinn – aus dem die Dividende ja stammt – vom Unternehmen bereits versteuert werden ist. Wollen sie dann ihre Wertpapiere wieder verkaufen, werden für die realisierten Kursgewinne erneut Steuern fällig. Auch deswegen sind für Anleger andere Alternativen wie geschlossene Fonds auf dem ersten Blick wesentlich attraktiver als der Aktienhandel, allerdings nicht immer vorteilhaft. Neben den ersten drei sozusagen „chronischen“ Gründen gibt es noch ein weiteres Argument, dass viele Deutsche beim Aktienkauf zögern lässt. Um die Jahrtausendwende wagten viele Privatanleger den Schritt an die Börse. Der Markt schien damals außerordentlich vielversprechend. Zahlreiche junge Unternehmen aus der IT-Branche konnten innerhalb kürzester Zeit überzeugende Renditen verbuchen und zum ersten Mal seit den 1960er Jahren wurde mit der Deutsche Telekom Aktie eine sogenannte „Volksaktie“ an die Börse gebracht. Plötzlich war der Aktienhandel ein Thema, das Einzug in Alltagsgespräche hielt und zahlreiche Privatanleger investierten zum ersten Mal in Wertpapiere – allerdings ohne die Grundlagen des Aktienhandels zu beachten. Sie investierten nur in wenige Unternehmen und streuten ihr Risiko nicht ausreichend. Als die Dotcom-Blase dann platzte und die T-Aktie innerhalb weniger Monate um 90 Prozent einstürzte, waren viele Privatanleger enttäuscht und zogen sich wieder aus dem Aktienhandel zurück. Deutsche investieren fast schon aus Tradition nicht in Aktien. Sie bevorzugen nach wie vor betriebliche Altersvorsorge und Bausparverträge, anstatt an der Börse mit vergleichsweise geringem Risiko erheblich bessere Renditen mitzunehmen. Wer 2000 in den DAX investiert hat, kann trotz der Krisen auf eine durchschnittliche Rendite von fünf Prozent jährlich zurückblicken. Anleger sollten sich also überlegen, ob sie gerade in Zeiten des Niedrigzinses weiter auf Festgeld und Bausparverträge setzen wollen oder ein Teil ihres Kapitals unter ausreichender Risikodiversifizierung an der Börse anlegen möchten.
Warum investieren so wenig Deutsche am Aktienmarkt?
Deutsche Anleger im internationalen Vergleich abgeschlagen
Warum kaufen Deutsche keine Aktien?
Aktienhandel nicht in der Kultur verankert
Aktien kosten zu viel
Pfadabhängigkeit zu Geldinstituten
Aktien sind steuerlich benachteiligt
Vertrauensverlust durch abstürzende Aktien
Fazit